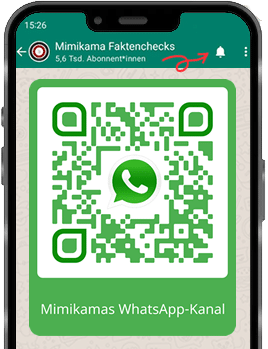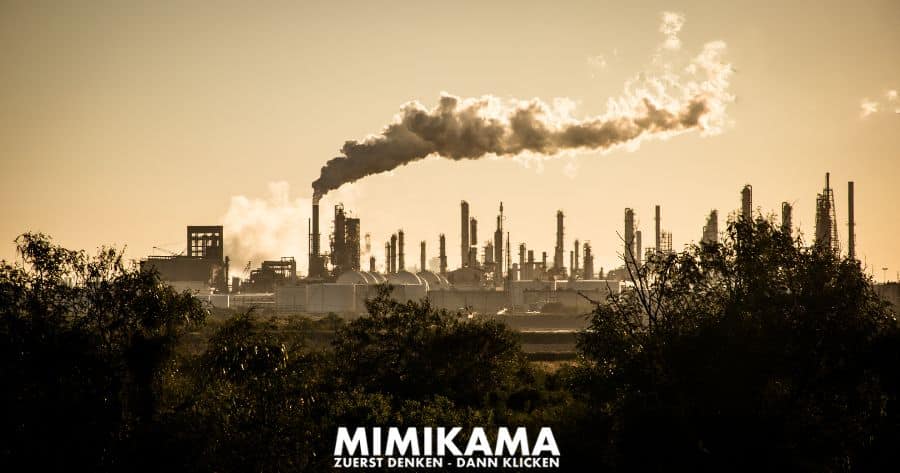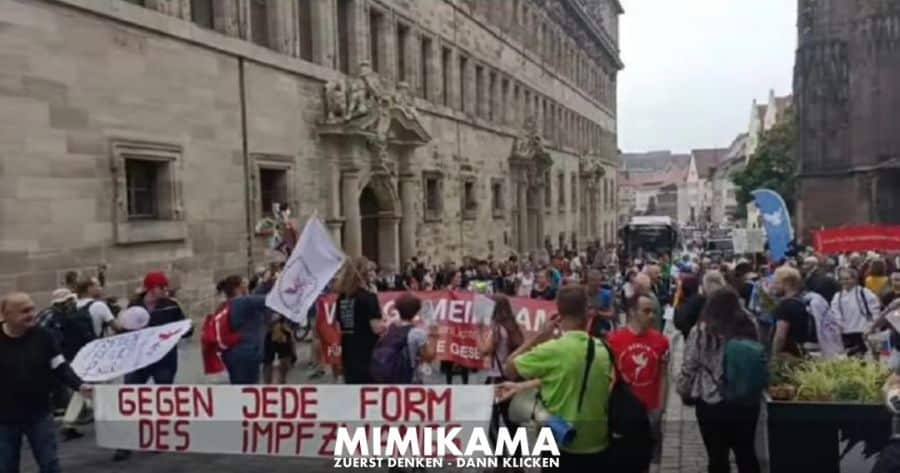Kinder entwickeln langfristige Immunität gegen COVID-19
Wir brauchen deine Hilfe – Unterstütze uns!
In einer Welt, die zunehmend von Fehlinformationen und Fake News überflutet wird, setzen wir bei Mimikama uns jeden Tag dafür ein, dir verlässliche und geprüfte Informationen zu bieten. Unser Engagement im Kampf gegen Desinformation bedeutet, dass wir ständig aufklären und informieren müssen, was natürlich auch Kosten verursacht.
Deine Unterstützung ist jetzt wichtiger denn je.
Wenn du den Wert unserer Arbeit erkennst und die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft für die Demokratie schätzt, bitten wir dich, über eine finanzielle Unterstützung nachzudenken.
Schon kleine Beiträge können einen großen Unterschied machen und helfen uns, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und unsere Mission fortzusetzen.
So kannst du helfen!
PayPal: Für schnelle und einfache Online-Zahlungen.
Steady: für regelmäßige Unterstützung.

In einer Studie kamen Forscher zum Ergebnis, dass Kinder eine stärkere Immunantwort nach einer COVID-19 Infektion aufweisen.
Den Verlauf einer COVID-19 Infektion bei Kindern und deren Rolle als Erkrankte, Infektionüberträger und -verstärker haben nun Wissenschaftler im Zuge der COVID-19 Familienstudie Baden-Württemberg untersucht.
COVID-19-Familienstudie Baden-Württemberg
Forscher der Uniklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sowie das Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut NMI in Reutlingen haben bei dieser Studie zusammengearbeitet. Finanziert wurde diese vom Land Baden-Württemberg und wurde am 23. Juli 2021 als Preprint veröffentlicht: Typically asymptomatic but with robust antibody formation: Children’s unique humoral immune response to SARS-CoV-2
328 Familien mit mindestens einem an COVID-19 erkrankten Angehörigen wurden während der Studie mehrfach untersucht. Teilgenommen hatten insgesamt 548 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie 717 Erwachsene.
COVID-19 Infektion bei Kindern
Der Titel der Studie gibt bereits einen Überblick über die Erkenntnisse. So ist die Immunantwort bei Kindern stabiler als bei Erwachsenen, auch ist ein asymptomatischer Verlauf bei einer COVID-19 Infektion bei Kindern fünfmal häufiger im Vergleich zu Erwachsenen.
Kinder stecken sich innerhalb einer Familie seltener an als erwachsene Familienmitglieder. Der Verlauf bei Kindern ist außerdem meist deutlich milder. Trotzdem entwickelt sich eine stärkere Immunantwort, die auch länger anhält als bei Erwachsenen – unabhängig davon, ob Symptome auftreten oder nicht.
Die kindlichen Antikörper waren außerdem gut wirksam gegenüber den verschiedenen Virus-Varianten. Somit zeigte sich, dass Kinder, die bei einer Erkrankung keine Symptome aufwiesen, nach einer Infektion geschützt sein sollten.
Keines der infizierten Kinder musste zu einer Behandlung in ein Krankenhaus.
Unterschiedliche Symptome
Interessant auch, dass sich die Krankheitszeichen bei Erwachsenen und Kindern unterschieden. Erwachsene beklagten Fieber, Husten, Durchfall und Geschmacksstörungen. Bei Kindern wiesen jedoch nur Geschmacksstörungen auf eine COVID-19 Infektion hin (87 Prozent). Erst mit einem Alter ab etwa zwölf Jahren zählten auch Husten und Fieber zu den Infektions-Anzeichen.
Fazit
Kinder, die von einer COVID-19 Infektion genesen waren, entwickelten trotz milder oder symptomfreier Verläufe eine länger anhaltende und sehr wirksame Immunabwehr, welche die von Erwachsenen sogar zu übertreffen scheint.
Das könnte dich auch interessieren: Woher kommt der Montagsblues?
Quelle: Deutsches GesundheitsPortal, Preprint-Studie
FAKE NEWS BEKÄMPFEN
Unterstützen Sie Mimikama, um gemeinsam gegen Fake News vorzugehen und die Demokratie zu stärken. Helfen Sie mit, Fake News zu stoppen!
Mit Deiner Unterstützung via PayPal, Banküberweisung, Steady oder Patreon ermöglichst Du es uns, Falschmeldungen zu entlarven und klare Fakten zu präsentieren. Jeder Beitrag, groß oder klein, macht einen Unterschied. Vielen Dank für Deine Hilfe! ❤️
Mimikama-Webshop
Unser Ziel bei Mimikama ist einfach: Wir kämpfen mit Humor und Scharfsinn gegen Desinformation und Verschwörungstheorien.
Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.
2) Einzelne Beiträge (keine Faktenchecks) entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und
wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)
Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum
INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE
Kämpfe mit uns für ein echtes, faktenbasiertes Internet! Besorgt über Falschmeldungen? Unterstütze Mimikama und hilf uns, Qualität und Vertrauen im digitalen Raum zu fördern. Dein Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft uns, weiterhin für eine wahrheitsgetreue Online-Welt zu arbeiten. Unterstütze jetzt und mach einen echten Unterschied! Werde auch Du ein jetzt ein Botschafter von Mimikama
Mehr von Mimikama
Mimikama Workshops & Vorträge: Stark gegen Fake News!
Mit unseren Workshops erleben Sie ein Feuerwerk an Impulsen mit echtem Mehrwert in Medienkompetenz, lernen Fake News und deren Manipulation zu erkennen, schützen sich vor Falschmeldungen und deren Auswirkungen und fördern dabei einen informierten, kritischen und transparenten Umgang mit Informationen.